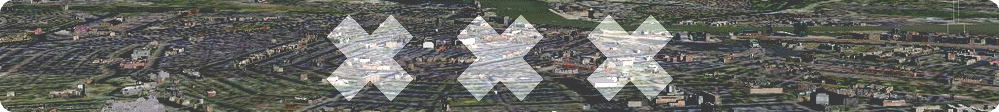
|
| ||
|
Ausblickend würde ich sagen, ich steuere auf ein schönes drittes Jahr hin. Und ich denke auch nicht daran, dass es schon mein vorletztes ist. Hätte man vom Weltall aus vorletztes Wochenende auf Westeuropa geschaut, wären einem orange Flecken aufgefallen und einer davon genau dort, wo Amsterdam liegt. Am 30. April war nämlich Königinnentag. Koninginnedag, wie man hier sagt, ist der Geburtstag der Königin und einer der wichtigsten Nationalfeiertage der Niederlande. Ein Blick zu Wikipedia könnte nun Verwirrung stiften. Hat Beatrix nicht im Januar Geburtstag? Stimmt. Und sie hat bei Amtsantritt verfügt, dass der Feiertag weiterhin am Geburtstag ihrer Mutter, Königin Juliana, stattfindet, weil im Januar meist schlechtes Wetter ist. Das nenne ich pragmatisch. Typical Dutch. Koninginnedag bedeutet feiern. Zwei Tage lang ist ganz Amsterdam auf den Beinen und in den Straßen, überall ist es bunt und laut. Und es gibt einige ganz besondere Traditionen. Sonntag. Die Stadt schmückte sich in der Nationalfarbe Orange, mit Bändern, Wimpeln, Luftballons und allen anderen Dekoartikeln, die es in Orange zu kaufen gibt. Leute klebten auf den Gehwegen Rechtecke mit Klebeband ab, als würden sie ein Revier für sich reservieren. Was damit wohl passieren würde? Ich fuhr abends in die Innenstadt, ein Ausländermeeting besuchen und dort Freunde treffen. Auf dem Weg dort hin: Unmengen an Feierwütigen. Zudem war überall Polizei, die sichtlich nervös wirkte. Koninginnedag heißt leider auch besoffene Idioten, Streit und Randale. Mein Treffen war in einer Bar im obersten Stock eines Hochhauses und mit fantastischem Blick über die feiernde Stadt. Leider machte sie gegen eins dicht und wir mussten und eine andere Kneipe suchen. Die ersten Partys endeten, die Leute schleppten sich nach Hause. Viele sahen nicht so aus als würden sie am wirklich wichtigen morgigen Tag zu sehen sein. Wir fanden einen Pub, versackten in Gesprächen und wanderten um drei Uhr Morgens zum Leidseplein. Menschenmassen auch hier, Orange, friedlich. Eine weitere Kneipe fanden wir an diesem Morgen allerdings nicht mehr und so trennten wir uns. Montag. 30. April. Perfektes Draußenseiwetter. Die Straßen waren voll von Leuten die, auf Decken ausgebreitet, altes Zeug verkauften. Dies war der Grund für die Reviermarkierungen am Vortag, Jeder hatte nun seinen abgesteckten Flecken eingenommen und wartete auf Kundschaft. Traditionsgemäß darf man am Koninginnedag verkaufen, was man will. Zumindest fast, Alkohol und solche Dinge sind verboten. Schnäppchenjägern wird empfohlen, früh auf die Märkte zu gehen um wirklich seltenes zu finden, ich war aber erst Mittag dort. Angeboten wurde tatsächlich alles erdenkliche, von Kleidung über Haushaltsgegenstände, alte Bücher und CDs, Selbstgebackenes und Selbstgebasteltes, Möbel, Schrapel. Koeniginndag ist Kellerausrümpletag. Ich fuhr mit dem Rad durch die Stadt, beobachtete Verkäufer und Käufer, Sammler und Schaulustige und jemanden, der seine soeben erstandene Couch auf dem Fahrrad davonwuchtete. Ganz besonders ging es zu im Vondelpark, wo ich von einer Freundin hingeladen wurde. Auch dort wurde eine Menge verkauft, aber ausschließlich von Kindern. Sie boten Spielzeug feil, Limonade, Kuchen, Poffertjes (mini-Eierkuchen, quasi), kleine Theaterstücke, Tanzeinlagen und Violinenperformances. Der Vondelpark ist an diesem Tag traditionell reserviert für die kleinen Verkäufer und ich habe gehört, dass dies der Ursprung von der ganzen Flohmarktidee war. Und Abends? Alles feiert, ich allerdings nicht, keine Lust. Laut und alkoholschwanger sind die Partys, gerade die Touristen gehen hier mit schlechtem Beispiel vorran. Jedem das Seine. Dafür passiert am Morgen ein Wunder. Noch bevor die Durchschnittspartyschnapsleiche am nächsten Tag ihren Kopf in Richtung Fenster wuchten kann um die Spuren der vergangenen Nacht zu sehen, haben sich Heinzelmännchengleich die Reinigungskolonnen durch die Stadt bewegt und alles aufgeräumt. Mittags gab es fast keine Spuren der Feiern mehr zu sehen. Nur in einigen zugeparkten Straßen, wo die Putzautos nicht durchkamen, stapelten sich Bierdosen, Müll und Partyüberbleibsel aller Art. In Orange, natürlich. Erst einmal: Euch allen nachträglich ein gesundes, schönes und erfolgreiches Jahr 2012! Ich hoffe, ihr seid alle gut und unfallfrei reingekommen! Beim kürzlichen Betrachten meines Webtagebuches musste ich feststellen, dass bereits eine Menge virtueller Staub auf dem letzten Eintrag lag. Die Webseite wartete sehnsüchtig auf eine Aktualisierung, doch seit langem hatte ich einfach keine Zeit dazu. Der Grund dafür: Ich schreibe gerade eine Geschichte. Gut, sagen wir mal, eine wissenschaftliche Geschichte. Ein Paper. Eigentlich beschreibt so ein Paper das Ergebnis einer wissenschaftlichen Arbeit und den Weg, wie man zu diesem Ergebnis gelangt ist. Uneigentlich ist es aber doch blos eine Geschichte, mit Anfang, Handlung, Spannungsbogen und Happy End. Und beim Paperschreiben gibt es die gleichen Probleme wie beim Geschichtenschreiben. Die Handlung muss geschlossen sein, also im Rahmen der Umgebung logisch von vorn bis hinten nachvollziehbar. Stellt euch vor, ihr seid die Gebrüder Grimm, die gerade an Schneewittchen schreiben. Die Story steht schon, Schneewittchen ist das schönste Mädchen weit und breit und es gibt da die böse Königin, den Jäger, die Zwerge, den vergifteten Apfel, Schneewittchens Tod und die Wiederbelebung. Und dann taucht wie aus dem Nichts ein logisches Loch auf. Wie zum Henker soll man begründen, dass der Apfel seinen Weg wieder aus Schneewittchens Hals herausfindet? Rein muss er erstmal, sonst wär ihr Ableben unlogisch. Drinbleiben kann er nicht, sonst wär die Wiederbelebung nicht nachvollziehbar. Der Heimlich-Handgriff war leider noch nicht erfunden und selbst wenn, wie hätte man begründen sollen, wieso jemand dem armen toten Schneewittchen von hinten um die Brust fasst? Schreibt man ein Paper, so trifft man mit hinreichend Pech auf genau solche Handlungslöcher, nur ohne Schneewittchen. So erging es mir. Ich hatte eigentlich den Inhalt für mein Paper fertig, als große Stichpunktliste. Die Problembeschreibung war da, Ergebnisse und eine Menge Details über die Arbeit meines letzten Jahres. Nur war die Handlung nicht ganz geschlossen. Kleinigkeiten fehlten, Dinge wie "Warum arbeite ich mit genau diesen Testdaten" oder "Warum habe ich die Einstellungen für mein Programm ausgerechnet so gewählt". Ich war frustriert, denn ohne vollständige Handlung konnte ich nicht mit dem eigentlichen Schreiben anfangen. Ich drehte mich im Kreis. Den Gebrüdern Grimm fiel für ihre Geschichte zum Glück der Trick mit dem stolpernden Zwerg ein, der durch Fallenlassen des Sarges einen apfelrausschleudernden Impuls auf Schneewittchen ausübte. Eine einwandfreie wissenschaftliche Erklärung für ihre Genesung, Story gerettet! Meine Story ist auch gerade am Gerettetwerden, ganz fertig bin ich aber noch nicht. Hoffentlich steht dann dem eigentlichen Schreiben bald nichts mehr im Weg. So ist der Forschungsalltag, wie mir Freunde inzwischen bestätigt haben. Alles ganz normal. Ich hoffe, meine Freunde haben recht. Und natürlich hoffe ich auf keine weitern Löcher in meiner Geschichte, sonst muss ich in mein Paper auch stolpernde Zwerge einbauen. In Amsterdam gibt es über eine Million Fahrräder. Das verwundert nicht wirklich, so lange man nicht weiß, dass es hier bloß eine Dreiviertelmillion Einwohner gibt. Das macht etwa eineinhalb Fahrräder für jeden Amsterdamer. Viele Leute hier haben ein Fahrrad zur Reserve am Bahnhof stehen, eines extra für Gäste oder für die Arbeit. Und alle Räder stehen draußen auf der Straße, was ein größeres Problem darstellt, als man annehmen könnte. Viele Velos werden an ihrem Abstellort vergessen oder absichtlich stehen gelassen und rosten, immernoch angeschlossen, vor sich hin. Nach Schätzungen der Stadt haben 15 Prozent aller Fahrräder draußen keinen Besitzer mehr und 40 Prozent der nicht mehr genutzten Räder stehen in der Innenstadt. Diese Fahrradwaisen verstopfen die Stellplätze, die Straßen, alle Orte, an denen man Räder anschließen kann. Würde die Stadt nichts dagegen unternehmen, so würde sie binnen weniger Jahre in Fahrrädern ersaufen. Und so versucht sie einerseits, auf das Problem aufmerksam zu machen, beispielsweise mit einer eigens für die Thematik eingerichteten Webseite oder auch mit einer riesigen Skulptur, gebaut aus alten Fahrrädern. Andererseits holen die Behörden jedes Jahr zehntausende Räder von den Straßen. Natürlich können sie diese nicht einfach losschneiden, es könnte ja sein, dass der Besitzer zurückkommt. Also geht das Ordnungsamt umher und verpasst verwaist aussehenden Rädern einen Aufkleber. Auffällig grell orange sind die Sticker, mit der Frage darauf, ob das Rad noch einen Besitzer hat und mit der Drohung, es ansonsten in ein paar Wochen abzuholen. Ich nenne diese Aufkleber Lootscheine. Looten, das ist das, was Rollenspieler und Computergamer mit ihren abgemurksten Gegnern machen, um an neue Waffen und Ausrüstungsgegenstände zu kommen. Klebt einmal ein solcher Aufkleber an einem entsorgt aussehenden Rad, so verliert es schnell Anbauteile. Leute kommen und schrauben verwertbare Dinge ab, und ich finde diese Idee gar nicht schlecht. Um die allermeisten Räder mit Sticker dran kümmert sich wirklich niemand mehr. Sie werden am Ende von der Stadt verschrottet oder bestenfalls verkauft, aber sie verursachen in jedem Fall Kosten. Nicht alle Teile haben dieses Schicksal verdient. Mir tut ja sowieso öfters mal kaputte Technik leid. So kam es vor zwei Wochen, dass ich bei uns um die Ecke ein aufgegebenes Fahrrad stehen sah, ohne Kette, Bremsen und Luft in den Reifen, dafür mit Rost und Dreck. Spontan habe ich es geschnappt und heimgebracht. Die genaue Begutachtung förderte ein intaktes, schickes Hollandrad zu Tage, viel zu schade zum Sterben lassen. Mit Kleinkram für unter 20 Euro habe ich es wiederbelebt, als Gästefahrrad für unsere WG. Noch ist es aber nicht ganz fertig. Noch bin ich nämlich am Suchen. Jedes Schrottrad mit Lootschein wird begutachtet, ich brauche für unser Gästerad noch einen schickeren Sattel, neue Pedale und einen besseren Schalter für die Gangschaltung. Das Basteln habe ich hier bisher echt vermisst und es macht eine Menge Spaß. Und ich habe einen Entschluss gefasst. Ich werde, jenseits von Kleinigkeiten, kein Geld mehr in Fahrradteile investieren. Wenn mein Mountainbike irgendwann auseinanderfällt, kaufe ich kein neues Fahrrad, sondern baue eins aus Altteilen. Es liegt schließlich genug herum und ich muss der Million Fahrräder hier nicht noch eines hinzufügen. Mit einem eigenartigen Gefühl von Melancholie schaue ich auf den Kalender. Da war doch etwas. Wo, denke ich mir so, war ich eigentlich genau vor einem Jahr um diese Zeit? Genau. Da saß ich im Zug, da begann meine abenteuerliche Reise, mein Lebensabschnitt Niederlande. Doch dazu gleich mehr. Vorher schaue ich im Geiste noch zwei Wochen weiter zurück. Ich war umgeben von Stress, war bei meinen Eltern und steckte inmitten der Vorbereitungen für die Reise. Gerade hatte ich meine Hallenser Wohnung abgegeben, die seit fast zehn Jahren mein Zuhause war. Zuletzt, noch während ich für meine letzte Prüfung gelernt habe, war sie schon fast leergeräumt gewesen und nun gab ich die Schlüssel zurück. Seltsames Gefühl. Als hätte ich ein Stückchen Heimat weggegeben. Ich holte mein Diplomzeugnis vom Prüfungsamt der Uni ab. Noch so ein seltsames Gefühl überkam mich, ein Mix aus Freude und Traurigkeit. Einerseits hatte ich die Uni abgeschlossen. Ich hielt das Ergebnis meines Studiums in den Händen, den Schlüssel zur Karriere. Andererseits hatte ich die Uni abgeschlossen. Eine Zeit, wie sie im Leben nie wiederkehren wird, endete. Eine Zeit, in der ich mich zum ersten mal frei gefühlt habe, eine Menge gute Freunde gewinnen und viele interessante Erfahrungen sammeln konnte. Die bislang beste Zeit meines Lebens. Ein Abschied war das Diplom, ein Abschied von dieser ganz besonderen Zeit. Und von Freunden, die ich nicht mehr um mich haben würde, wenn ich Halle verlasse. Nun ging es in die Ferne, ohne Pause, ohne Besinnung zwischendurch. Ernstes Arbeitsleben. Ich wollte es so. Letzte Woche in Deutschland. Ich habe noch einmal gute Freunde besucht und mich verabschiedet, man weiß nie wie gut Kontakte überleben. Ein paar Formalitäten auf den Ämtern, Abmelden, Nein, kein neuer Wohnort in Deutschland, Ja, es geht ins Ausland. Die letzten Tage zuhause waren geprägt von akribischer Planung. Es verlief alles gut und ohne Hektik, und doch war ich eigenartig angespannt. Man bereitet sich nicht jeden Tag auf eine Reise vor, die einen in ein neues Stück Leben führt. Nichts weniger war dies hier. Ich ging im Kopf Kleinigkeiten durch, technische Details, wollte nicht darüber nachdenken, wie ich mich fühlte dabei. Zudem war die Reiseidee uneingeschränkt als verrückt zu bezeichnen. Eine Bahnreise sollte es sein. Als Gepäck hatte ich zwei große Rucksäcke, einen vorn, einen hinten. Und mein Fahrrad, welches mit drei großen Fahrradtaschen vollbepackt war. Fünfzig Kilogramm Dinge. Mehr brauchte ich nicht für mein neues Leben. Ich konnte mich mit meiner Fuhre ganz gut fahrend fortbewegen, das hatte ich vorher ausprobiert. Der Abschied war schwer und sentimentaler, als ich befürchtet hatte. Die Reise begann am späten Nachmittag. Regenwetter. Ich fuhr mit Regionalzügen, weil man dort das Rad besser unterbekommt und weil es billiger war. Dafür dauerte die Fahrt lange und ich musste oft umsteigen. Ich hatte die Route so gelegt, dass ich zur Nachtpause, die die Regionalbahnen haben, in Münster bin und nicht in irgendeinem traurigen Winzigbahnhof im Niemalsland. Es half, weil es dort Nachts um zwei Kaffee gab und einen warmen Platz zum Sitzen. Eigenartige Stimmung während meiner Pause, Müdigkeit. Gegen vier ging es weiter. Ich passierte die Grenze und wechselte mehrmals den Zug. Die Rucksäcke zogen beim Umsteigen an meinen Schultern, und das schwere Rad durchs Gedränge schieben war auch alles andere als einfach. Dass es verboten ist, zur Berufsverkehrszeit Fahrräder mit in den Zug zu nehmen, wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Gegen Mittag: Amsterdam. Ende der Reise. Vorerst. Samt meiner schweren Fuhre setzte ich mich nach Verlassen des Bahnhofs in Bewegung, meinen Vermieter suchen. Die richtige Straße fand ich nach einer Weile, das Büro der Wohnungsgesellschaft nach einer halben Stunde. Schlüssel abholen ging schnell, ich war angemeldet. Nun hieß es, meine Wohnung zu finden. Eine Odyssee begann, quer durch den Süden Amsterdams. Es fing an mit Regnen. Ich hatte mir zuhause eine Karte ausgedruckt, die jedoch die Fahrradstraßen nicht enthielt. Autostraßen sind hier oft eine Ebene höher gelegen und für Radfaher gesperrt und so kam es, dass ich völlig die Orientierung verlor. Der Regen wurde stärker, ich hatte seit 30 Stunden nicht geschlafen und fuhr mit meiner Zentnerfuhre suchend und fragend durch die Stadt. Verzweiflung kam in mir hoch, zusammen mit der Nässe und Kälte ein beklemmendes Gefühl. Meine Karte gab den Geist auf, zerfetzt vom häufigen Falten im Regen. Ich fragte einen nächsten Passanten nach dem Weg, und wieder bekam ich verwirrende Antworten, die mir nicht weiterhalfen. Wie viele Passanten hatte ich nun schon um Hilfe gebeten? Nächster Versuch. Endlich Glück, ich erwischte jemanden, der die Straße und das Wohngebiet kannte und quasi nebenan wohnte. Er führte mich hin. Ich schloss die Haustür auf, stellte mein bepacktes Rad ins Treppenhaus und ging zur Wohnung. Insgesamt brauchte ich vier Stunden für die Suche, und ich habe während dieser Zeit das richtige Gebiet mehrmals umrundet. Das Apartment selbst war ein weiterer Schock, den ich nie vergessen werde. Ein trister dreckiger Flur. In der Küche gab es keine einzige Fläche, auf der man etwas hätte abstellen können, ohne dass es kleben geblieben wäre. Überall lag Müll herum, auf dem Boden in der Küche, im Flur, auf dem Balkon. Das Klo war von der Eingangstür aus geruchlich als solches auszumachen, und die ehemals weißen Fliesen hatten die Farbe von all dem angenommen, was bei kleinen und großen Geschäften danebenging. Die Dusche war einheitlich vergilbt und halbkaputt. Einzig mein Zimmer war ein Lichtblick, wenigstens. Es war sauber und ordendlich, die Möblierung schick und intakt. Ich entlud das Fahrrad, warf die Taschen in mein Zimmer. Zum Schluss schleppte ich mein Fahrrad die Treppe hoch und schloss es im Hausflur oben an. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass wir einen Keller haben. Ich rief zuhause an und teilte den Eltern mit, dass ich da bin. Ich war fest davon überzeugt, dass ich in diesem Drecksloch nicht bleiben möchte. Todmüde fiel ich ins Bett und schlief ein, nach eineinhalb Tagen auf den Beinen. So hatte ich mir den Start nicht vorgestellt. Ich schlief unruhig und lange. Die nächsten Tage sahen nicht mehr ganz so trist aus. Ich lernte meinen italienischen und meinen brasilianischen Mitbewohner kennen. Sie waren freundlich und zeigten mir erstmal ein wenig die Stadt. Die Wohnung konnte man reinigen, defekte Dinge reparieren. Ich erforschte die nähere Umgebung, ging einkaufen, war das erste mal auf Arbeit. Erste Woche überstanden. Und die nächsten Wochen sollten noch besser werden. Ich arbeitete mich ein. Erledigte Formalitäten. Ich fühlte mich wohl in der Wohnung. Meine Mitbewohner wurden mir über die Zeit zu Freunden. Ich war mitten drin im Abenteuer Amsterdam. Das ist nun alles etwa ein Jahr her. Ein Jahr! und es kam mir gar nicht lang vor. Zwischendurch habe ich so viel erlebt. Niederländische Lebensweise. Forschungsalltag. Große und kleine Konferenzen. Eine Reise in die USA. Verrückte Partys. Ich habe Freunde besucht zuhause, und Freunde haben mich besucht. Ich bin in eine bessere Wohnung umgezogen. Das ist ein Jahr Amsterdam!! Mal von dem holperingen Start abgesehen, genieße ich meine Zeit hier. Ich habe es nicht bereut, hier herzukommen. Neue Freunde habe ich gefunden und viel Kontakt zu alten Freunden aufrechterhalten. Die Fahrradaktion würde ich nicht noch einmal so machen, aber auch die bereue ich nicht. Ich fühle mich wohl! Und freue mich auf die nächsten dreihundertfünfundsechzig Tage! Ich bin wieder daheim in Amsterdam. Da sich in meiner Abwesenheit nur unspannende Dinge hier ereignet haben, gibt es wieder keine längere Geschichte. Dafür Updatebröckchen-Ladung Nummer zwei.
Ist es wirklich über einen Monat her, seit ich meinen letzten Blogeintrag verfasst habe? Herrje. Es ist aber auch wirklich schwer, über spannende Dinge zu schreiben, wenn nichts passiert. Es ist nämlich Sommer! Oder besser formuliert: Sommerloch. Okay, ich hätte vom Wave Gotik Treffen in Leipzig schreiben können. Da war ich letztens und es war einfach nur toll. Aber das hier ist ja mein Amsterdamwebtagebuch. Und ich werfe dahinein jetzt einfach ein paar kleine Informationsbrocken, statt eine zusammenhängende Geschichte zu schreiben.
Das Universitätsgebäude, in dem ich arbeite, wurde vor einem Jahr eröffnet ist ein sehr modernes, schönes Stück Architektur. Jede Ecke ist individuell gestaltet, es gibt nur wenig Symmetrie im Inneren und alles ist offen und weiträumig. Das Bauwerk ist ein Kunststück, eine abstrakte Skulptur. Der Bildhauer dieses Meisterwerks hat nur nie daran gedacht, dass darin Leute arbeiten sollen. Seit Anfang an gibt es von den Mitarbeitern Beschwerden, wegen zu hohem Lärmpegel, flackerndem Licht, zu wenig Stauraum und anderen Unannehmlichkeiten. Pausenlos wird deswegen am Gebäude optimiert. Verantwortlich für das alles sind, zumindestens meiner Meinung nach, die Kamper. "Een Kamper ui is een verhaal waarin een stad worden bespot." erklärt dazu die niederländische Wikipedia. Auf gut Deutsch: Eine kamper ui ist eine Geschichte, in der über eine Stadt gespottet wird. Besser gesagt, über die Stadt Kampen und ihre Bewohner. Kamper sind die niederländische Variante der Schildbürger, und die zeichnen sich bekanntermaßen dadurch aus, dass sie eine Dummheit durch eine noch größere Dummheit zu korrigieren versuchen. Unsere Bürofläche hat ein ganz besonderes Design. langgestreckt ist sie, und zu den beiden langen Seiten offen. Die einzelnen Büros sind mit großen Regalen von einander abgetrennt. Es gibt zum Gang rechts statt Türen und Wänden seitlich verschiebbare Panele. Auf der anderen Seite des Büros ist ein Geländer. dahinter geht es zwei Etagen runter bis zum Erdgeschoss. Diese Idee hinter dem ganzen Aufbau war, das ein offenes Büro die Kommunikation fördert. Das bedeutet schlichtweg, dass jeder im Büro jeden im Büro reden hört. Und nicht nur das. Man hörte von hier oben aus einfach alles, was unten so passierte. Diskutierende Studenten. Geräusche aus der Kantine. Leute, die im Eingangsbereich der Uni Ping-Pong spielen. Nachdem sich die Büroarbeiter über den Lärm beschwert haben, wurde auf der linken Seite eine Glaswand eingezogen. Diese verringert den Lärm ein wenig, dafür sieht der Bereich nun von außen wie ein Tiergehege aus. Und die Reinigungskräfte haben ziemliche Probleme, die Scheiben von außen sauberzuhalten. Kleinere Schildbürgerhaftigkeiten sind zudem die folgenden:
Nach allen Optimierungen, die sicher noch diverse Jahre dauern und Budgets sprengen werden, sieht unser Büro dann wahrscheinlich aus wie ein langweilig-gewöhnliches, mit Wänden, Türen, Schränken und Lichtschaltern. Ich freue mich schon drauf. Handymäßig gesehen bin ich ein konservativer Mensch. Ich habe ein ältliches Mobiltelefon, das ich zum Telefonieren und für Kurznachrichten benutze. Ich habe noch nie eine MMS verschickt, einen Klingelton heruntergeladen oder mir eine WAP-kastrierte Webseite angeschaut. Schon eine Weile lang überlegte ich mir dennoch, dass eigentlich ein Smartphone für mich praktisch wäre, zum mobil Surfen, als Navigation auf Reisen und als Musikspieler. Für letzteres verwendete ich bisher einen uralten batteriefressenden MP3-Player, vorletzteres besitze ich nicht und meinen mobilen Surfspaß beendet der lahme Akku meines Netbooks stets nach eineinhalb Stunden. Die Qual der Wahl bei neuen Handys ist von ganz besonderer Güte. Das Angebot an Geräten ist gewaltig. Gewaltig unübersichtlich. Sollte ich für ein schickes Designersmartphone meine Seele an Steve verkaufen? Oder mir einen günstigen Plasteandroiden holen? Oder was ganz proprietäres? Zusätzlich suchte ich nach einem niederländischen Mobilfunkanbieter. Das sollte einfacher sein als die Telefonsuche. Dachte ich. Ich suchte nach einem günstigen "Sim-Only" Angebot, und wurde bald bei einem der hiesigen Billiganbieter fündig. "Sonderangebot noch bis Ende Mai" informierte mich die Webseite des Anbieters. Ich wurde blos nicht so recht schlau darüber, wie viel ich denn nun insgesamt zu bezahlen hatte. Schon deutsche Handyanbieter sind Meister im Verstecken von Informationen, frei nach dem Motto: Preise siehe AGB Kapitel "Tarife Mo-So", Abschnitt "alle Zeiten außer Januar, Mittwochs und Abends". Niederländische Anbieter scheinen nicht besser zu sein, zumindestens nicht dieser. Die Webseite bietet Hilfesuchenden einen Bereich "Veelgestelde vragen", der Antworten auf häufige Fragen liefern soll. Ich las alles komplett durch und erfuhr unter anderem, wie man als Kunde einen zweiten Vertrag abschließt, zu einem teureren Angebot wechselt oder dem Anbieter dank "Zwei Euro per Megabyte"-Internet gleich ganz die Eurozeichen in die Augen treibt. Darüber, wie lange mein Vertrag laufen würde oder ob sich der Zahlbetrag zwischendurch noch erhöht, fand ich nichts. Erst hinter einem Link auf der eigentlichen Bestellseite entdeckte ich dann doch noch die gewünschten Infos. Das bis eben günstig erscheinende Sparangebot entpuppte sich als teure Mogelpackung. Ich wählte ein kleiners Angebot ohne Rabatt. Zum mobil Surfen reicht es und zum Vieltelefonierer werde ich sowieso nicht mehr. Blieb noch die Frage nach dem Telefon. Ich entschied mich mich für ein eigenwilliges Kästchen namens N900, hergestellt vom bekannten finnischen Mobilfunkriesen. Aufmerksam wurde ich auf das Ding durch einen Freund, der eines besitzt. Eigentlich ist das Gerät ein kleiner Linuxrechner, dem man das Telefonieren beigebracht hat. Es ist ein Handy für Computernerds, man kann es sehr frei konfigurieren und hat Zugriff auf das gesamte Dateisystem. Dafür ist Ottonormaltelefonierer sicher überfordert damit und konfiguriert es kaputt. Es war vom Hersteller aber auch weder für Jedermann konzipiert noch war es ein Verkaufsrenner. Ich habe meines günstig gebraucht gekauft. Natürlich kann es schnelles Internet, Musik und Videos, Navigation und E-mail. Und wenn es was nicht kann, bringt man es ihm durch Herunterladen von Freeware bei. Klappt mit allem, außer Kaffee kochen. Sobald mein Vertrag ankommt, kann ich mit dem Ding sogar telefonieren. Etwa einmal im halben Jahr hält jeder von uns Mitarbeitern einen Vortrag vor der Arbeitsgruppe über die aktuellen Fortschritte der eigenen Arbeit. Letzten Freitag habe ich meinen zweiten Vortrag dieser Art gehalten. Während der Vorbereitung zu meiner neuen Präsentation habe ich meinen ersten Vortrag dieser Art aufgemacht und nachgeschaut, was ich meiner Arbeitsgruppe damals so berichtet habe. Das war im Dezember, kurz vor Weihnachten. Von unseren 15 Gruppenmitgliedern waren damals nur fünf anwesend und es war eine gemütliche kleine Runde, ohne Stress, und ohne Chef. Wie konnte ich damals nur eine halbe Stunde Redezeit füllen? Ich hatte fast nichts zu berichten. Ich habe erzählt, dass ich Netzwerke aus Proteinen untersuche. Dass die biologischen Proben, mit deren Messdaten ich arbeite, von Mäusen stammen, und die Experimente von einer Kollegin in China gemacht werden. Ich habe erzählt, wie ich versuche, aus den Daten etwas interessantes herauszubekommen, Ergebnisse hatte ich noch nicht vorzuweisen. Nur ein paar vage Vorausahnungen, in welche Richtung das ganze einmal geht. Seit dem sind sechs Monate vergangen. Langsam bildet sich für mich ein Weg heraus, ein grobe Richtung, in die ich gehen muss in meinen nächsten vier Jahren. Ich habe ein wesentlich besseres Bild von meiner eigenen Arbeit, erste Ergebnisse und viel zu erzählen. Demzufolge war meine Präsentation deutlich umfangreicher diesmal. Ich sprach eine Dreiviertelstunde und hatte dabei den Eindruck, diesmal wirklich Information zu übermitteln. Das Feedback war gut, der Vortrag ein Erfolg. Chef zufrieden. Ich auch. Details darüber, Was genau ich hier eigentlich mache, gibt es demnächst in einem allgemeinverständlichen Beitrag in meinem Webtagebuch. Versprochen. Bis dahin reicht die Information, dass es was mit armen Mäusen zu tun hat, die ich zum Glück nicht zu sehen bekomme. Bekanntermaßen wohne ich in einer WG hier, eine Einzelwohnung ist für mich unbezahlbar. Von meinen ehemaligen Mitbewohnern Fabi und Rafa habe ich früher schon ab und zu einmal erzählt, und auch, dass sie seit Weihnachten leider nicht mehr hier sind. Seit dem hatte ich nur noch einen Mitbewohner, der aus China stammt. Mit Fabi und Rafa habe ich damals wirklich WG-typisch zusammengewohnt. Wir sind Abends oft weggegangen, haben Dinge zusammen geplant und unternommen, gemeinsam Essen gemacht. Mein chinesischer Mitbewohner und ich hingegen wohnten im wesentlichen neben einander her. Das Reden war schwierig (er spricht nur schlecht englisch), es gab keine gemeinsamen Interessen, wir ist nie auf ein Bier weggegangen oder haben zusammen gekocht. Seit Januar war mein WG-Leben daher ziemlich Öde. Mein Wohnungsgenosse und ich hatten außerdem, sagen wir mal, unvereinliche Meinungen über die Sauberkeit der Wohnung und das Zusammenleben allgemein. Details lasse ich weg, weil ich niemanden beleidigen will. Wie dem auch sei, ich wollte raus aus der Bude. Meine Wohnung ist von der Uni gestützt und speziell für ausländische Mitarbeiter im ersten Jahr gedacht. Ende August hätte ich also sowieso ausziehen müssen. Am Housing-Helpdesk (Unserem Büro für Wohnungsangelegenheiten) erfuhr ich, dass ich einen Nachmieter brauche, wenn ich schon vorzeitig ausziehen will. "Die Uni bietet auch Wohnungen auf dem so genannten freien Sektor an", erklärte mir die freundliche Mitarbeiterin weiter. Diese sind geeignet für all jene, die länger als ein Jahr hier sind. Ich musste also warten, bis sich ein Nachmieter fand, und das Büro ein WG-Zimmer in diesem so genannten freien Wohnungssektor frei hatte. Ersteres passierte vor einen Monat. Jemand besuchte meine WG, schaute sich das freie Zimmer an und wollte einziehen. Gleichzeitig gab es einen freien WG-Platz für mich in einer anderen Wohnung. Bevor ich mich geistig auf den Umzug vorbereiten konnte, sagte der Kandidat plötzlich ab, und der Helpdesk musste mich vertrösten. Man wollte mir aber sofort Bescheid sagen, wenn sich wieder eine Chance ergab. Vorletzte Woche war ich in Deutschland und hatte eine wunderbare Zeit mit Freunden und Familie. Regel Nummer Eins im Urlaub: Keine Arbeits-Emails lesen. Natürlich habe ich die Regel gebrochen. Zum Glück. "Sehr geehrter Herr Kutzera, [..bla bla ..] WG-Zimmer verfügbar, Nachmieter gefunden, er will sofort einziehen [..bla..] sie können noch diese Woche umziehen" lautete sinngemäß übersetzt die Email vom Helpdesk. Da war gerade Montag, ich saß in Halle und dachte an Murphys Law. Am Ende zeigten sich die Kollegen vom Helpdesk sehr kulant. Sie gaben mir die Chance, eine Woche später umzuziehen und steckten meinen Nachmieter in einen der freien Räume meiner WG. Ich musste mich aber gleich entscheiden. Problemchen nur: ich musste die Katze im Sack mieten. Ich sollte dem neuen Wohnungsangebot zusagen, ohne die Wohnung je gesehen, oder die Mitbewohner kennengelernt zu haben. Ich kannte die Straße von außen, Streetview sei Dank. Schick sah's aus, und näher an der Uni gelegen als die alte Wohnung war es auch. Ich ging das Risiko also ein. Ich sagte zu. Und notierte mir, dass ich eine Luftmatratze mitnehmen muss auf der Rückreise, das neue Zimmer war nämlich unmöbliert. Als ich nach Amsterdam zurückkam, war mein Nachmieter schon in das freie Zimmer eingezogen. Der neue ist aus Norddeutschland, Informatiker (was sonst) und sehr freundlich. Er macht gerade seinen Master und ist blos zwei Monate hier. Letzten Montag habe ich dann auch spontan die neue WG besucht. Beide Mitbewohner sind, so wie ich, Doktorranten, und arbeiten im gleichen UNI-Gebäude wie ich. Einer ist aus Rumänien und auch Informatiker. Nummer zwei ist Mikrobiologe und waschechter Bayer. Mit den beiden wird es hoffentlich lustig, die ersten Eindrücke waren jedenfalls prima. Die Wohnung selbst ist einfach nur toll. Groß, modern, zwei Stockwerke (Wohnzimmer und Küche unten, Schlafräume oben) hell und freundlich. Volltreffer. Ich glaube, ich bring eine Packung Pralinen bei unserem Helpdesk vorbei wenn alles fertig ist. Vergangenes Wochenende bin ich umgezogen. Samstag: Packen und Zimmer ausräumen. Es ist schon verwunderlich, wie viel Kram sich in einem halben Jahr ansammelt. Zog ich einst mit voll beladenem Fahrrad hierher und konnte alles allein transportieren, so kann man damit jetzt bestimmt einen Kleintransporter füllen. In Ansterdam war an diesem Tag übrigens Königinnentag, und eigentlich ist es schade, dass ich weder an den Feierlichkeiten teilgenommen habe (Ganz Amsterdam spielt verrückt) noch darüber berichten kann. Nächstes Jahr mache ich beides, versprochen. Sonntag: Umzug. Mein Nachmieter bot mir zum Glück tatkräftige Hilfe an. Ich mietete einen VW Caddy, und wir luden das Ding bis unters Dach voll. Passte prima, alles mit einem mal. Und schnell waren wir dabei auch noch. Es war das erste mal überhaupt, dass ich in Amsterdam Auto gefahren bin. Amsterdam ist von Stadtautobahnen durchzogen, die als Brücken, teilweise übereinander gelegen, die Stadtteile verbinden. Man muss vorher genau wissen, welche Abfahrt einen zum Ziel bringt, und wenn man sich verfährt, dann sehr gründlich. Ich war demzufolge froh, dass mein Kumpel ein Telefon mit Navigation hatte. Verfranst haben wir uns aber trotzdem ein wenig. Mit dem Ausladen am Zielort waren wir ebenfalls erstaunlich schnell fertig. Ich hatte den Transporter einen ganzen Tag, und so sind wir spontan noch zu Ikea gefahren, Möbel kaufen. Und statt auf der Luftmatratze, die ich extra aus Deutschland mitgebracht hatte, schlief ich die Nacht auf meinem neuen 140er-Bett. Die Katze im Sack hat sich am Ende als Glückgriff erwiesen. Ich hoffe, der Eindruck bleibt so. Ich fahre zur Arbeit und zurück jeden Tag mindestens 10 Kilometer mit dem Rad. Meine Fitness wird dadurch leider nicht unbedingt verbessert, da die einzelnen Stecken zu kurz sind, als dass sich ein Trainingseffekt einstellen würde. Dazu müsste ich wenigstens 15km am Stück fahren. Früher in Halle habe ich regelmäßig große Fahrradtouren gemacht, dafür habe ich hier leider noch keine Zeit gefunden. Ein Arbeitskollege von mir joggt regelmäßig. Er empfahl mir, doch stattdessen auch mal eine Runde zu laufen. Ich habe ihn gefragt, welche Distanz ein guter Einstieg ist. Seiner Meinung nach sollte ich mit nicht mehr als zwei Kilometern anfangen. Vorgestern habe ich das mit dem Jogging ausprobiert, zum ersten mal seit Jahren. Zwei Kilometer. Das ist wirklich wenig, sind fünf Minuten auf dem Fahrrad und klang nicht, als würde mich das erschöpfen. Während eines Trainingsdurchgangs in egal welcher Sportart (Ausgenommen Schach) erreicht man nacheinander verschiedene Stadien der Energieversorgung im Körper. Die ersten Minuten Leistung erbringt der Mensch spontan mit den Zuckervorräten, die so in den Muskelzellen selbst schlummern. Evolutionärer Hintergrund davon: Tiger sieht Äffchen. Äffchen sieht Tiger. Äffchen muss um Leben rennen, ohne Zeit zu haben, um sich auf den Sport vorzubereiten. Äffchen überlebt vorerst. Wenn dieser Vorrat alle ist, wird neuer Zucker zu den Muskeln rangekarrt, aus dem Blut und anderen schnellen Speichern. Das funktioniert mit fließendem Übergang aus dem ersten Stadium und sorgt dafür, dass unser Äffchen nach drei Minuten nicht einfach umfällt und doch Tigerfutter wird. Ist allerdings auch dieser Speicher leer, wird es spannend. Es gibt einen Schalter im Körper, und wenn der aktiviert wird, stellt sich der Stoffwechsel auf Ausdauerleistung um. Es wird nun so viel Energie bereitgestellt, wie man verbraucht, und das über einen sehr langen Zeitraum. Das Problem mit diesem Schalter ist: er wird überwacht. Und zwar vom inneren Schweinehund. Dieser sorgt dafür, dass man sich nach dem Aufbrauchen von Energievorrat Nr. zwei erst einmal schlapp und kraftlos fühlt, obwohl die Dauerenergie noch gar nicht angetastet ist. Unerfahrene Sportler hören nun auf mit Sport und wundern sich über den ausbleibenden Trainingseffekt. Unser Äffchen denkt gerade nicht über Schweinehunde nach und rennt einfach. Dem Tiger ist die Affenjagt zu doof und er erspäht stattdessen eine Gruppe moppeliger Touristen. Wenn man die Phase der Schlappheit überwindet, verbessert man seine Leistungsfähigkeit. Beim Radfahren früher kam die Schweinehundgrenze nach etwa 10 Kilometern, wirklich Sense mit meiner Energie war dann drei Stunden und weitere 50km später. Achja, Wie nun mein Joggen war? Nach 500 Metern merkte ich, dass meine Schuhe ungeeignet sind zum Laufen. Nach einem Kilometer taten mir die Füße weh. Dazu gesellten sich auf dem zweiten Kilometer meine schmerzenden Beine, die diese Art der Anstrengung überhaupt nicht gewohnt sind. Mein Körper muss sich erst an das Laufen gewöhnen. Immer langsamer werdend kam ich relativ fertig wieder zu hause an, lange bevor ich meinen inneren Schweinehund vom Powerschalter schuppsen konnte. Einen Tag später spürte ich meine Beine immer noch. Mein Kollege hatte recht. Zwei Kilometer sind schon gut für den Anfang. Diese Woche will ich drei versuchen.
Im Rijksmuseum gab es einiges zu entdecken: Puppenhäuser, Rembrandtbilder und -Skulpturen. Das Highlight war das Portrait von Eric Cartman, in der Zeit bekannt unter Gerard Bicker (gemalt von Bartholomeus van der Helst, http://tinyurl.com/6an4x36). Nach dem Museum: Kaltes Wetter, heiße Suppe!
Tag zu Ende - Steph und Ioana kaputt - aber Ioanas Fahrrad auch - Houston, we have a problem! - Lösung: 2 Stunden Crosstraining ohne Crosstrainer - Preis für unsere Leistung: Joe hat auf uns mit Pizza und Bier gewartet.
Danach "Science" - Museum Nemo. Großes Spielparadies für Kinder, allerdings nicht für Ioanas und Stephs. Fazit: Kann man sich schenken! Ein kleiner Spaziergang von Nemo brachte uns zu unserer ultimativen Chill-Oase: die Amsterdamer Bibliothek - so geil!!! - moderne Architektur, Klaviermusik am Eingang, bequeme Sessel vor größen Fenstern mit mega toller Aussicht - so geil!!!. Danach "schnell" zu Joes Arbeitsplatz, dem Science Park, gefahren. Die Architektur der Uni ist beeindruckend: modern und verwinkelt und nicht zu vergessen, dass man hier keine Privatsphäre hat. Es gab Freibier - was für eine Uni!!! Danach sind wir in das Rotlicht-Viertel gefahren - Ioana durfte Joes Fahrrad nehmen und ihm das Vergnügen bereiten mit einem Gurkenfahrrad zu düsen. Unser Ziel war das Erotikmuseum, was sich allerdings als echtes Pornomuseum entpuppte: die Zeichentrickfilme Fickinger, Raumficker und Richard Eisenschwanz waren ein echtes kulturelles Erlebnis. Es gab auch den ersten Vibrator - zu medizinischen Zwecken damals benutzt - zu sehen. Danach ohne kaputtes Fahrrad nach Hause zu Joe.
Joe haben wir auch dort getroffen und wir haben eine Runde gechillt und Ioana hat Postkarten geschrieben. Die Fahrt nach Hause war unspektakulär - mittlerweile kannten wir den Weg ohne Stadtplan. Nach dem Abendessen haben wir uns dem Dessert gewidmet - leckerer Amsterdamer Kuchen. Dazu wollten wir natürlich Godzilla-Filme gucken, aber nicht irgendwie, sondern auf Japanisch mit englischen Untertiteln. Leider war die Größe der Untertitel nicht Steph- und Ioana-freundlich, deswegen sind wir auf South Park umgestiegen und haben die Folge: "Drugs are bad, mkay" gesehen. Ioana wurde bald müde und ist schlafen gegangen. Steph und Joe haben noch weitere Serien geguckt, aber irgendwann war die Steph verwirrt und konnte sich nicht mehr konzentrieren-also war schlafen angesagt.
Am Abend sind wir mit der Metro in die Stadt gefahren und hatte gleich die erste Enttäuschung: die Absintherie, die uns von 3 Reiseführern so herzlich empfohlen wurde, gab es nicht mehr. Danach hat Joe vergebens nach einer Kneipe gesucht, die er uns gern zeigen wollte. Wir waren stattdessen in einem mexikanischen Restaurant gelandet und haben mexikanisches Bier getrunken (alle außer Steph, die Bavaria probiert hat.) Danach kleiner Spaziergang ins Pacific - eine coole Tanz-Bar, mit gemütlichem Feuer und großen gutaussehenden Barkeepers. Leider haben uns die Live-Band und der Dj nicht überzeugt. Draußen sind wir einer coolen Musik gefolgt und landeten auf einer großartigen Party, die an Ton aus Strom erinnerte. Die Djs (Terry Toner, Anthony Rother und 2000 and One), ihre Beats, die Lichtshow und die Leute waren cool. Ioana hat man nur umarmt von sehr großen gutaussehenden holländischen Typen gesehen (bis auf einen, der war klein, hässlich und nicht holländisch, aber er durfte sie auch nicht umarmen).
Metro niet, Zug niet, Fuß niet, Bus yeah!!! Kurz nachm Sonnenaufgang zu Hause. Zum Glück hat Joe tolle Vorhänge. Bis um 1 geschlafen - Steph ein bisschen weniger, weil wir sie in der Küche mit ihrer geliebten Süddeutschen Zeitung gefunden haben, die endlich angekommen war. Steph war richtig glücklich. Einkaufen - auf Joes Wunsch mit den Gurkenfahrrädern - leider wusste er nicht unser Fahrrad-Omen einzuschätzen - Folge: 2. Fahrrad kaputt! Doch nach Hause laufen. Lecker kochen - Lasagne, viele laute Chinesen im Haus (Hui, Joes Mitbewohner, der immer mit offener Tür pinkelt, hatte Besuch). Danach Kino - "Rango", schöne Bilder, aber soooo langweilig - Steph und Ioana sind mal zwischendurch eingeschlafen, Joe war aber tapfer und hat ihn von Anfang bis Ende gesehen. Zu Hause angekommen, gleich ins Bett gegangen, da wir noch von der Party müde waren - unsere letzte Nacht in Amsterdam.
Auf dem Weg zum Bahnhof nochmal kurz die Sonne genossen. Zug da - eingestiegen - Tschüß, Amsterdam!!! Vielen Dank, Joe, es war super! Momentan bin ich im sonnigen Kalifornien. Freitag startet hier meine Konferenz, deren Reisevorbereitung mir so viel Kopfschmerzen bereitet hat. Einen geschlossenen Reisebericht wird es nicht geben, dafür werfe ich ungeordnet kleine wichtige und unwichtige Informationsbrocken in mein Webtagebuch. Mittwoch: Anreisetag
Donnerstag: Mein erster freier Tag
Freitag: 1. Konferenztag
Samstag: Zweiter Konferenztag
Sonntag: Letzter Konferenztag
Montag: Frei.
Dienstag: Abreise.
Vor einigen Monaten schlug mein Chef vor, ich könnte Mitte März eine Konferenz in den USA besuchen und mich dort informieren, was gerade up to date in meinem Fachgebiet ist. Ort des Treffens ist La Jolla, ein Städtchen in Südkalifornien. Für Forscher wäre es dort völlig langweilig, wenn nicht eines der größten Bioforschungszentren der USA dort seine Heimat hätte. In dessen Umfeld findet die Konferenz statt. Natürlich habe ich mich riesig auf den Besuch gefreut und ansonsten vergessen, dass so eine Reise ja gut vorbereitet sein will. Es war am Mittwoch der vorletzten Woche, als mich der Gedanke förmlich erschlug, dass ich schleunigst mal mit den Vorarbeiten anfangen sollte. Seit dem bin ich am Rotieren. In alten Adventure-Computerspielen musste man oft Puzzles lösen, Beispielsweise Rätsel wie "Um den Hammer vom Zimmermann zu stehlen muss man erst woanders eine Säge kaufen, einem schlafenden Piraten das Holzbein absägen, damit dieser den Zimmermann zum Reparieren rufen muss, und dann zum klauen den Moment nutzen, den Werkstatt unbewacht ist." Wie die Hauptfigur dieses berühmten Adventures fühle ich mich auch gerade. Allerdings läuft dem Möchtegernpiraten im Spiel nicht die Zeit davon. Aber von vorn.
Mein Adventure neigt sich bald seinem Ende zu, glücklicherweise. Den Stress hätte ich mir sparen können, nächstes mal fange ich früher an, meine Reise zu planen. Ich bin jetzt seit genau fünf Monaten in Amsterdam. Seitdem habe ich so einiges erreicht. Ich habe ganz gut Fuß gefasst und mich in meine Arbeitswelt hineingefunden. Ich spreche fließend englisch und beginne so langsam, niederländisch zu verstehen. Ich habe neue Bekanntschaften gemacht, die eventuell später zu Freundschaften werden. Alles in allem Grund für mich, zufrieden mit mir zu sein. Mir gefällt es in Amsterdam, oder sagen wir mal, was ich bisher gesehen habe, gefällt mir. Es ist nicht so, dass ich die Niederlande schon einschätzen könnte oder die Niederländer, aber ein wenig mehr gesehen als der typische Tourist habe ich mittlerweile, bin tiefer in dieses Land eingetaucht. Ganz nebenbei ist dies hier mein zwanzigster Tagebucheintrag. Deswegen möchte ich ihn nutzen, um eine kleine Top 10 der Dinge vorzustellen, dir mir hier besonders gefallen.
Normalerweise bin bekanntlich ich derjenige, der seine Umgebung mit Gemecker und Geläster erfreut. Momentan is es mal umgekehrt. Alle um mich herum meckern. Am Wochenende ist es nämlich geschehen. Das neue Wartungssystem für die Windows-Rechner in unserer Abteilung wurde installiert. Es heißt UvA-Werkplein (UvA-Arbeitsplatz) und es soll die Bürorechner vereinheitlichen, die Pflege der Software erleichtern und die Sicherheit verbessern. Aktuell kann ich meine Kollegen in zwei Gruppen einteilen. Gruppe eins bilden die Leute, die sich über ihren Rechner beschweren, weil nach der Erneuerung nichts mehr funktioniert. Gruppe zwei sind die Kollegen, die sich nicht beschweren. Sie haben die Runderneuerung noch vor sich oder sitzen, so wie ich, vor einem Linuxrechner. Meine Kollegin neben mir tippt etwas Text in ihren Rechner und muss fünf Sekunden warten, bis er auf dem Bildschirm erscheint. Ein Programmwechsel dauert bei ihr jetzt eine Minute, das Starten von Matlab hat sie nach einer Viertelstunde Wartezeit aufgegeben. Die andere Arbeitsgruppe, mit der wir das Büro teilen, beschwert sich über verlorene Daten und darüber, dass sich die Leute nicht mehr am System anmelden können. Ein anderer Kollege meiner Gruppe vermisst einige seiner Programme, die vorher noch vorhanden waren. Der nächste Kollege vermisst alle seine Programme und rennt frustriert durch die Flure, weil er so gar nicht arbeiten kann. Ein armer Servicemensch der Rechnerbetriebsgruppe läuft durch die Abteilungen und listet die Leute auf, bei denen es Probleme gibt. Er hat eine sehr, sehr lange Liste. Und alle nölen auf ihn ein, er tut mir richtig leid, weil er sicher nicht selbst für die Umstellung verantwortlich ist. Unser eigener Admin müht sich ebenfalls nach Kräften um zu helfen, aber die Verantwortung und die Passwörter für den Zugriff liegen bei der Rechnerverwaltung hier. So kann ich nur hoffen, dass die Arbeitsplätze bald wieder ordendlich funktionieren, ich habe heute schon Ansätze eines wütenden Mobs gesehen, der in Richtung Rechnergruppe ziehen wollte. Ich bin wieder Student. Zumindestens fühle ich mich so, seit ich zurück auf Arbeit bin. Ich besuche eine Vorlesung über Biodatenanalyse, zusammen mit unseren anderen beiden neuen Doktorranten. Wir sitzen also unter lauter jungen Gesichtern im Hörsaal und lauschen dem Dozenten. Es ist ein Kurs für Masterstudenten und er ist zum Glück auf Englisch, mein Niederländisch steckt noch in sehr kleinen Kinderschuhen. Niedlich sind sie, die Studierenden. Jung, motiviert, manchmal laut, völlig planlos. So wie ich früher. Achja, war das Studentsein schön, ich vermisse diese Zeit, auch wenn sie noch nicht weit zurück liegt. Und es ist eigentlich schade, dass meine Erinnerung daran schon jetzt so langsam verblasst. Wir drei stehen den Professoren näher als der Rest, sind es doch Kollegen aus unserer Arbeitsgruppe. Eine Extrawurst gebraten bekommen wir aber nicht. Auch mein Chef hält einen Teil der Vorlesung, als Student hätte ich ihn wohl sehr lustig gefunden, dafür aber nicht besonders ernst genommen. Er weiß, vovon er redet und hat die typisch chaotische Art eines zerstreuten Professors. Die Übungsaufgaben, die wir machen müssen, haben es ganz schön in sich. Ich benötige momentan meine gesamte Arbeitszeit zum Ausarbeiten der Lösungen, pro Woche kommen so etwa 20 Seiten Text und Diagramme zusammen. Jeder muss seine Ergebnisse einzeln abgeben, eine Abgabe als Gruppe ist nicht vorgesehen. Die Aufgaben sind aber lösbar und tatsächlich lehrreich. Analyse von Biodaten, das heißt, man verwendet komplizierte statistische Methoden auf Messdaten an um herauszufinden, welche Teile davon wichtig sind und welche nicht. Und natürlich gibt es eine Menge Tricks, um jene Ergebnisse ans Tageslicht zu bringen, die einem am besten gefallen. Frei nach dem Motto: "Traue nie einer Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast." Am Ende wird das Ganze benotet, so wirklich wichtig ist die Bewertung für uns Mitarbeiter aber nicht. Die letzten beiden Wochenenden habe ich tagsüber in der Uni verbracht, unser Gebäude ist rund um die Uhr geöffnet. Ich mag die Stille dort am Wochenende, unter der Woche ist Dank Studenten und Arbeiten immer ein gewisser Geräuschpegel vorhanden. Zum Abschluss des Kurses muss ich eine wissenschaftliche Ausarbeitung lesen und eine Zusammenfassung dazu schreiben. Noch eine Woche etwa darf ich mich wie ein Student fühlen, bevor mein Doktorrantendasein wieder den Alltag bestimmt. Darauf freue ich mich dann aber auch wieder. Ich habe mir ein neues Notebook gekauft. Schick ist es, mit breitem Display, drei Rechenkernen und Windows 7. Und wer mich kennt, kann sich denken, dass ich wahrscheinlich absolut zufrieden mit der Vorinstallation des Computers war und nie auf die Idee gekommen wäre, sie abzuändern. Naja, fast. Zuerst einmal ging es der ganzen überflüssigen Software an den Kragen, die mir dank Autostart gleich beim allerersten Einschalten entgegensprang. Ich frage mich bis heute, wieso neue Computer immer mit so vielen nutzlosen Anwendungen ausgestattet sein müssen. Ob jemals sich jemand darüber gefreut hat? Wenn ich mir ein Auto kaufe, bekomme ich doch auch keine Sitzwärmer, Außenspiegelschützer und Zigarettenanzünder-Sandwichmaker dazu. Nach einer Stunde Deinstallationsakkord war mein Notebook um etwas Worksartiges, eine 30tage Virenscannerdemo, mehrere kunterbunte Multimediahelferchen, Powerpointreader und weiteren Schnickschnack leichter, und der Autostartorder sah sichtlich aufgeräumter aus. Mit der Aufteilung meiner Festplatte war ich natürlich auch unzufrieden. Es gab nur ein einziges, riesiges Laufwerk. Wann lernen die Hersteller, dass man für Daten und Programme besser zwei getrennte Partitionen anlegt? Zu meiner Verwunderung kann der Windows Partitionsmanager neuerdings Partitionen verkleinern, ohne dass alle Daten dabei verschütt gehen. Das funktionierte früher nicht. Und jetzt ist es auch noch nicht wirklich ausgereift. Die Windows-Partition ließ sich zwar verkleinern, aber nur um einen viel geringeren Wert, als ich wollte. Also musste Voodoo ran. Voodoo, das sind bei mir alle Arbeiten am Computer, die experimentellen Status haben, auf die Ottonormaluser nie kommen würde und bei denen ich vor dem PC sitze und bete, dass am Ende mein Rechner noch hochfährt. Ungabonga! Voodoo Teil eins war Partitionen anpassen, mit Ubuntu Linux. Gegen dessen Partitionstool ist das Windows-pendant ein Kinderspielzeug. Laufwerk verkleinern ging auf Anhieb, die sinnfreie Wiederherstellungspartition wurde ins Jenseits befördert. Neue Partitionen für andere Betriebsysteme habe ich angelegt und Alles an den Plattenanfang verschoben. Das Abarbeiten meiner Änderungen dauerte dann zwei Stunden. Und ich saß davor und betete. Ungabonga. Danach ließ sich mein Windows 7 nicht mehr starten. Seine Daten lagen ja nun auf einer anderen Partition. Zum Glück hatte ich eine Setup-CD parat (Danke, MLU-Halle und Microsoft Studentenprogramm; denn diese gibt es schon lange nicht mehr automatisch zum neuen Notebook dazu) mit der ich die Booteinstellungen reparieren konnte. Mit Voodo zwei wollte ich Windows XP installieren, für Computerspiele. Dessen Setup schlug bereits am Anfang fehl, weil XP meine Festplatte nicht erkannte. Also XP-CD auf den Rechner kopieren, nachschauen, welchen Festplatten-Controller mein Noti hat, Treiber suchen, herunterladen, in das Setup einbauen, CD neu brennen. Warten. Ungabonga. Setup starten. "Passende Datei nicht gefunden.". Ich habe den falschen Treiber eingefügt. Also noch einmal von vorn. Den richtigen Treiber ins Setup einfügen, Neue CD braten. Diesmal hat es funktioniert. nach dem Neustart fand allerdings nun XP seine Partition nicht mehr. Und 7 startete nicht mehr. Zu wenig ungabongat. Wie ich 7 wiederbelebe, wusste ich ja schon, und tatsächlich klappte die Reparatur auch erneut. Dafür ignorierte es nun völlig, dass XP gerade neben ihm eingezogen war, und ich konnte XP nicht mehr starten. Ein Freeware-Bootmanager aus dem Internet löste das Problem, er kann mit XP und 7 gleichermaßen umgehen und funktionierte auf Anhieb. Bingo. Und natürlich Ungabonga. Die Ernüchterung kam bei der Suche nach einem Grafikkartentreiber für WinXP. Ein Foreneintrag irgendwo im internet erklärte, dass es ihn vielleicht im März geben wird. Dummerweise war der Eintrag vom Januar 2010. XP wird nicht mehr unterstützt, das war es dann wohl mit meinem Spielebetriebssystem. Und was habe ich nun, nach etwa 4 Tagen Arbeit? Zufriedenheit. Nun ist es mein Rechner, mit dem ich effizient arbeiten kann. Und was mache ich mit XP? Da hilft auch kein Voodoo mehr, zum Spielen brauche ich Grafik. Ich glaube, ich gehe einen Pakt mit dem Teufel ein, und installiere Windows Vista. Seien mir die guten Geister des Voodoo gnädig! Ich wünsche allen Lesern ein gesundes neues Jahr voller großer und kleiner Erfolge. Ich bin wieder gut in Amsterdam angekommen, motiviert an meine Arbeit zurückgekehrt und bin gespannt, was 2011 so bringt. Hoffendlich merkt keiner, dass dieser Eintrag etwas verspätet in meinem Webtagebuch aufgetaucht ist. Über Weihnachten bin ich nicht in meinem mittlerweile liebgewonnenen Amsterdam, sondern bei meinen Eltern im beschaulichen Harz. Ich möchte Bekannte besuchen und Verwandte, mit meiner Familie die besinnlichen Tage feiern und mit Freunden das weniger besinnliche Sylvester. Mein Plan für die Heimreise war todsicher. Letzten Monat hatte ich meinen Flug gebucht, er startete um 7 Uhr Abends. Von meiner Wohnung bis zum Bahnhof brauche ich 10 Minuten zu Fuß, bis zum Flughafen 20 Minuten mit der Bahn. Was sollte also schiefgehen? Freitag, 17. Dezember, Morgens. In der Nacht hatte es geschneit, nicht viel, aber immerhin fünf Zentimeter. Amsterdam fiel aus allen Wolken, nirgendwo wurde gestreut und die Autofahrer rutschten zur Arbeit. Das Radfahren zum Institut war abenteuerlich, aber möglich. Bis zum Nachmittag schneite es weitere fünf Zentimeter. Vor meinem Fenster starteten Studenten eine Schneeballschlacht. Alle Buslinien wurden abgesagt. Ich aktualisierte die Webseiten von Airline und Bahnen im Minutentakt, keine Spur von abgesagten Verbindungen. Zumindestens nicht auf meiner Strecke. Die Fahrradfahrt nach Hause war abenteuerlicher als die am Morgen und ich brauchte eine Viertelstunde, um mein festgerostetes Fahrradschloss abzubekommen. Ich sah wie ein Fahrraddieb aus dabei, und fühlte mich auch so. Meine Mitbewohner, die mir zu guten Freunden geworden sind, sehe ich erst einmal nicht wieder. Sie waren hier nur für vier Monate und fahren in ihre Heimatländer zurück. So war der Abschied am Abend rührend und ich hoffe, ich sehe sie mal wieder. Dreiviertel Fünf. Ich prüfte ein letztes mal online die Züge und meinen Flieger, keine Probleme. Und so machte ich mich vollbepackt auf den Weg zum meinem Bahnhof und löste ein Ticket. Der Zug zum Flughafen stand auch schon da. Fängt gut an, dachte ich. Der Zug fuhr blos nicht los. Aus der Bahn schauten mich deprimierte Gesicher an und ich erfuhr, dass sie schon eine Stunde steht und niemand wusste, wann sie abfährt. Kein Problem, mein Flieger startete erst in zwei Stunden. Nur die Ruhe. 20 Minuten warten. "Wegen Wintereinbruch massive Störungen im Bahnverkehr" sagte mir die niederländische Anzeige im Bahnhof. Auf der Webseite klang das noch anders. Und dann kam die Durchsage, dass von hier aus heute gar nix mehr zum Flugplatz fährt. Nur vom Hauptbahnhof aus. Spontan erwachten die Menschenmassen im Zug, strömten heraus und auf den Bahnsteig für die Metro. Ich mittendrin. U-Bahn Nr. eins war unvorstellbar voll, wie man es aus dem Fernsehen von Tokyo kennt. Keine Chance auf Einstieg. Und keine freundlichen Mitarbeiter, die einen in die Bahn schieben, wie in Tokyo üblich. In Metro zwei hatte ich gerade so Platz und kam 10 vor 6 auf dem Hauptbahnhof an. Habt ihr als Kind mal einen Stock auf einen Ameisenhaufen geworfen und dann dem chaotische Treiben zugesehen? Genau so fühlte es sich auf dem Bahnhof an. Nur, dass ich eine schwer bepackte Ameise war, und nicht das staunende Kind. Alle Reisenden wollten schellstens irgendwo hin, es wusste blos keiner, wo. Die Anzeigemonitore waren ausgefallen und zeigen einen allgemeinen Hinweis über Schnee und Zugausfälle. Ab und zu fuhr ein Zug in eine zufällige Richtung, das Bahnsystem steckte irgendwo zwischen "drei Viertel aller Züge wurden abgesagt" und "wir improvisieren gerade einen Notfallfahrplan." Die dichteste Menschentraube versammelte sich an einer Stelle, an der die Mehrzahl der Leute eine Bahn zum Flugplatz vermutete. In 20 Minuten schloss mein Check-In Schalter, mir lief die Zeit davon. Ein Teil des Bahnsteigs wurde von Bahnmitarbeitern abgesperrt, zu viele Leute wollten in den einzigen Zug Richtung Flieger. Fünf nach Sechs. Endgültig begrub ich meinen Plan, heute noch abzufliegen. Ich traf eine Kollegin, die erfolglos versuchte, eine Bahn nach Belgien zu finden. "Das Chaos gibt es hier in den Niederlanden jedes Jahr, sobald der erste Schnee fällt" erzählt sie mir, "in Belgien haben die Bahnen kein Problem". Ich hatte mal irgendo gelesen dass die Hälfte der Bahntechnik hier aus Deutschland kommt, das könnte alles erklären. Wie machen dass beispielsweise die Russen blos? Super. Mein Flieger würde ohne mich Richtung Berlin starten. Ein freier Platz im Jet, und ich würde dafür bezahlen. Der worst case war eingetreten. Ich hatte die Anfälligkeit der Bahnen hier völlig unterschätzt. Ich machte mich frustriert zurück auf den Weg in die WG, wenigstens sind die U-Bahnen nicht ausgefallen. Dafür erzeugte meine Bahn wegen dem Schee auf den Stromschienen beim Fahren links und rechts einen tollen Lichtbogen. Meine Freunde begrüßten mich grinsend und Fabi sagte mir, dass er Pasta zubereitet. Meine Laune besserte sich. Notebook auspacken, Internet an, Flug checken. JA! Mein Jet wurde abgesagt. Wie praktisch jeder andere Flug an diesem Abend, drei Stunden vorher las sich das noch ganz anders. Wenigstens kann ich ihn nun rückerstatten lassen. Und wie komme ich nun nach hause? Samstag morgen. Ich sitze in der Bahn von meinem Bahnhof aus direkt nach Hannover. Und dann weiter Richtung Heimat. Noch gibt es keine Probleme. Noch. p.s. Und es gab auch keine auf der gesamten Strecke .. ich bin gut in meiner Heimat angekommen. Eineinhalb Monate, bevor ich mein Abenteuer PhD-Stelle hier begonnen habe, bekam ich eine E-mail vom Administrator meiner zukünftigen Arbeitsgruppe. Er bestellte gerade meinen PC und wollte wissen, welches Betriebssystem ich gerne hätte. Da für mich Windows zum ernsthaften Arbeiten nicht in Frage kommt, wählte ich Linux. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, WIE gut diese Entscheidung war. Geliefert wurde mein neuer Rechner pünktlich zwei Wochen, nachdem ich hier angefangen habe. Und er hat die Computerverwaltung der Uni nie von innen gesehen, zumindestens haben sie weder den Karton aufgemacht noch das Ding irgendwie vorbereitet. Frisch zum Selbstauspacken war er also, mit dem typischen Geruch von eingewickelten Neugeräten. Und mit Windows Vista home Premium. Also gab mir unser gruppeneigener Admin eine CD mit Ubuntu Linux darauf, und meine erste Amtshandlung auf meinem neuen PC war, das sorgfältig vom Hersteller installierte Windows plattzumachen. Dabei hatte ich einen Gesichtsausdruck wie der Terminator beim berühmten "Hasta la vista, baby". Die Tage danach verbrachte ich damit, mein beliebtes Betriebssystems mit dem Pinguin zu installieren und anzupassen. Mit Programmierumgebungen, Editoren, Office-Programmen, Skype, ICQ und was der Computergeek von heute sonst noch so braucht. Die meisten meiner Mitarbeiter sitzen vor Windows-PCs, einige wenige haben Macs. Die Windowskisten werden von den hauseigenen Administratoren betreut, nicht von meiner Arbeitsgruppe selbst. Für jede Kleinigkeit müssen sich meine Kollegen also an die Computerverwaltung wenden, und alle Nasen lang gibt es irgendwelche automatischen Verbesserungen an den Rechnern und im Netzwerk, und natürlich eine Menge Probleme. Diese werden aber wenigstens per E-mail vorher angedroht. "Achtung Mitarbeiter, am Freitag installieren wir das neue Office, welches sich dann die kommenden zwei Wochen beschweren darf weil irgendwelche nutzerspezifischen Einstellungen von Karl Klammer fehlen."; "Heute Nachmittag installieren wir eine neue Fernwartungssoftware, bitte bleiben sie eingeloggt, arbeiten sie aber nichts."; "Mit dieser neuen Fernwartung müssen wir nicht mehr zu ihnen kommen sondern können ohne Sie zu fragen einfach blind drauflosreparieren"; "Am Wochenende zieht der Server um, ab jetzt haben sie ein anderes Login und die Hälfte ihrer gewohnten Windowsprogramme ist entweder weg oder läuft amok." Die ganzen Probleme lassen meinen Recher herzlich kalt, einmal wegen Linux, und auch, weil die Admins vergessen haben, meinen Rechner vorzubereiten. Nur dadurch konnte ich alles selbst machen und bin Herr und Meister auf meinem PC, was für ein Segen. Und ich hänge an einem anderen Netzwerk als der Rest. Aus Sicherheitsgründen. Und ich kann, wenn ich will, von Zuhause auf meinem Rechner arbeiten. Und von hier aus auf dem Server in meinem guten alten Institut in Halle. Okay, ich muss mich selbst um mein Backup kümmern, und kann nicht so einfach auf mein eigenes Verzeichnis im Netzwerk zugreifen. Aber das sind lösbare Probleme. Dafür läuft Karl Klammer nicht Amok. In meinem Wohngebiet ist jeden Sonntag Abend Sperrmüll, was nicht bedeutet, dass die Stadt jede Woche offiziell sperrigen Abfall abholt. An den Müllplätzen stehen sogar überall Schilder, die das Abladen von großen Gegenständen untersagen. Es hält sich nur niemand daran. Also holt die Stadt den Müll jeden Montag Morgen ab und versucht gar nicht erst, die Leute anderweitig umzuerziehen. Viele Bewohner meines Viertels leben hier nur vorrübergehend. Das hat zur Folge, dass oft recht neue Dinge weggeworfen werden. Meine Mitbewohner und ich sind einige Male Abends durch die Straßen gezogen, um nach der Party den Kopf frei zu bekommen. Und um zu sehen, was es so gibt auf dem Basar der entsorgten Dinge. Gefunden haben wir beispielsweise guterhaltene Schränkchen für mein und für Fabis Zimmer, Lampen, einen Deckel für den Spülkasten, sowie hilfreichen Kleinkram wie Kleiderbügel, Dekoartikel und neue, unbenutzte Fahrradteile. Der Dekokram ist in Fabis Besitz übergegangen, worüber ich nicht traurig bin. Die Fahrradteile werden demnächst an meinem Rad ihren ersehnten Einsatz erleben. Eines Abends fanden wir auf einem der Haufen einen Baum. Zwei Meter groß und ziemlich Dürre, mit einigen wenigen Blättern dran, und noch mit Schild vom Baumarkt. Jemand hat ihn sehr lieblos weggeworfen. Ohne Topf und mit klumpigen Erdresten an der Wurzel. Er tat uns wirklich leid. Also wurde spontan entschieden, dass er zu schade für den Müll ist. Wir haben ihn mit nach Hause genommen und auf den Balkon gebracht. Und ihm einen alten Blumentopf spendiert, den wir noch hatten. Und etwas Erde mit Tonsteinchen drin. Und wir haben das Unkraut entfernt, was aus dem Erdklumpen wucherte. Und unseren Baum gegossen. Und dann haben wir ihn bei Nachtfrost draußen vergessen. Infolge dieses Temperaturschocks fing unserer neuer "Mitbewohner" an, all seine verbliebenen Blätter erst zu entfärben und dann zu verlieren. Zu Anfang dachte ich noch, es mussten blos ein paar Blätter dran glauben und der Rest erholt sich wieder, jetzt wo er im Warmen in unserer Küche steht. Am Sonntag danach war der Baum komplett kahl, sah trocken, drahtig und ziemlich tot aus. Mehr als zwei Wochen lang. Gegossen haben wir auch nicht mehr, und einzig und allein unserer Faulheit ist es zu verdanken, dass wir den Baum Sonntags Abends nicht wieder auf den Sperrmüll zurückgebracht haben. Dann bemerkte ich an einem der dürren Zweige plötzlich ein kleines, zartes Blatt. Ich dachte zuerst, er hat es vergessen auf seinem Weg zum Trockengesteck, aber es war tatsächlich neu, frisch und grün. Also habe ich unseren Baum wieder gegossen und die toten Zweige abgeschnitten, also die, die selbst für mich als tot zu erkennen waren. Ich habe hoffentlich nicht zu viele lebende Teile erwischt. Bald darauf erschien ein zweites Blatt. Und ein Drittes. Mittlerweile hat unser Baum mehrere neue Triebe und scheint sich an seinem Platz wohlzufühlen. Nächste Woche kaufe ich neue Erde. Und einen ordendlichen Topf. Ich will schließlich nicht, dass das Ding noch einmal fast das Zeitliche segnet. Als Ausländer in Holland habe ich erst einmal vor allem andere Ausländer kennengelernt, weil sie in einer ähnlichen Situation sind wie ich. Natürlich habe ich Kontakt zu Niederländern, viele meiner Kollegen aus der Arbeitsgruppe stammen von hier. Aber weggehen und feiern tue ich mit meinen Mitbewohnern und deren Freunden, alles Leute von anderswoher. Zumindest war das bis vor kurzem so. Dann bin ich mit einer Kollegin aus dem Nachbarbüro ins Gespräch gekommen. Sie studiert medizinische Chemie, trägt immer schwarze Klamotten, mag morbide Kunst und ist insgesamt ziemlich schräg. Und aus Holland. Wir haben uns sofort prima verstanden. Ab und zu machen wir nun was zusammen. Samstag war ich auf ihre Geburtstagsparty eingeladen. Es war meine erste private Party dieser Art hier und sie war einfach nur toll. Eine Party wie ich sie von Zuhause kenne, viele Leute, Futter, Bier, leckere andere Alkoholien (Absinth, skittles in Wodka,..), und natürlich Musik. Und viel interessantes zu besprechen, z. B. die Tatsache, dass die Hälfte der Partygesellschaft schon mehrmals auf dem WGT in Leipzig war und die Leute deswegen meine ehemalige Lieblingsnachbarstadt etwas kennen. Zuende war die Feier wie gewohnt am frühen Morgen, und leicht angeheitert auf dem Rad nach hause fahren hab ich auch früher schon geübt. Das Essen auf der Party war etwas ganz besonderes. Meine Kollegin probiert gern einmal ungewöhnlich Dinge aus, und so hat sie die meisten Snacks in einem asiatischen Supermarkt eingekauft, und bei vielem nur geraten, was es eigentlich ist. Zumindestens gabs wohl vom Verkäufer eine grobe Einordnung was süß ist, und was herzhaft. Da war zum einen ein Snack, der so wie die bekannten Keksriegel aussah, blos ohne Schokolade. Die Kekshülle hat merkwürdig süß geschmeckt. Darin verborgen war eine grüne Masse, die geschmacklich stark an Fisch erinnerte und wohl Seegras oder so etwas beinhaltete. Ich habe nicht mehr als einen Bissen gegessen und den Rest liegengelassen. Die anderen taten dasselbe. Dann gab es kleine Becherchen mit so einer Art farbigem Gel drin, wie Wackelpudding, blos fester. Der Geschmack war unbeschreiblich künstlich, etwas fruchtig und süß. Im Gel waren kleine Würfel, die wohl Obststücke darstellen sollten. Sie hatten die Konsistenz von Knete und schmeckten auch etwa so. Ich hab mit den Gedanken gespielt, den Wackelpudding unter Strom zu setzen und zuzusehen, wie die Würfel der Grösse nach geordnet durch das Gel wandern. Am Ende habe ich ihn dann aber doch einfach gegessen. Dann gabs asiatischen Getränkesirup, zum Limonaden mixen. Er war wesendlich höher konzentriert als ich das kannte, und nach dem ich meine angemixte Brause auf 3 Becher verteilt und erneut verdünnt hatte, war sie langsam trinkbar. Mit Wodka drin. Platz Eins der kulinarischen Merkwürdigkeiten war eine Schale mit etwas, was wie grüne Würmer aussah, die in Wasser schwammen. Laut Verkäufer im Asiamarkt soll es eine pflanzliche Süßspeise gewesen sein. Dennoch habe ich jede Sekunde damit gerechnet, dass die Würmer anfangen zu zappeln und uns anzufallen. Nur wenige Leute haben gekostet, einer davon war ich. Das Wasser war salzig, und die grünen Fäden geschmacklos. Und sie sind doch nicht aus ihrer Packung geflohen. Etwas normalere Dinge gabs dann auch. Riesenzwiebelringe. Scharfer Reissnack. Kuntabunt gefärbte Chips aus gepufftem Mais mit Krabbengeschmack. Wasabierdnüsse. Und was ähnlich aussehendes mit Knoblauchgeschmack. Und billige Kartoffelchips. Die hab ich mitgebracht. Die Tüte war sehr schnell leer. Am Ende sind dann doch alle satt geworden, aber wenn ich hier ne Party schmeiße kaufe ich langweiliges normales Futter ein! Lebensmitteltechnisch gibt es nicht viele Unterschiede zwischen den Niederlanden und Deutschland. Das Nahrungsangebot im Supermarkt ähnelt dem deutschen stark und ich musste meine Essgewohnheiten hier kaum umstellen. Besonders der Lidl bei uns um die Ecke sieht aus wie komplett per Hubschrauber aus Deutschland eingeflogen. Was ich hier allerdings vermisse, ist gutes Brot. Es gibt hier praktisch nur Weißbrot zu kaufen, welches leicht, luftig und sehr weich ist. Selbst nach dem Toasten ist es schwierig, Butter daraufzuschmieren, dichtes Mischbrot ist hier unbekannt. Ungeschnittenes Brot übrigens auch. Früher habe ich ab und zu Sauerteigbrot gebacken. die Idee dazu, und der erste Sauerteig kamen von meiner Schwester, und nach ein paar Fehlschlägen am Anfang sind mir die Brote immer ziemlich gut gelungen. Auf meiner Fahrt hierher war leider kein Platz für Backutensilien, also konnte ich diese Tradition erstmal nicht fortsetzen. Vorletztes Wochenende hat sich das geändert. Meine Eltern haben mich besucht und mir einen Sauerteig (Danke, Schwesterchen), Backform und Roggenmehl mitgebracht. Letzte Woche habe ich den Teig gefüttert und er ist mit Freuden wieder zum Leben erwacht. Das Backen selbst war allerdings gar nicht ganz so einfach. Zuerst ging es ans Mehl Abmessen. Unser Messbecher misst in Tassen, Unzen und Esslöffeln. Muss wohl aus einer Zeit vor dem metrischen System kommen. Ich hab mehr geschätzt als gemessen. Danach Kneten. Wir haben keine Rührschüssel. Ich habe den Teig in einem großen Edelstahltopf gemacht, obwohl Sauerteig das angeblich nicht verträgt. Aufgegangen ist er danach in der Backform aber trotzdem prima. Letzter Schritt: Backen. Der Herd in unserer Küche ist eine Klasse für sich. Er ist eigentlich gasbetrieben, aber die Backröhre läuft elektrisch. Sie hat nur einen Drehknopf, dessen Beschriftung nicht mehr existiert. Ich kann nur raten, welche Stellung welche Funktion aktiviert. Mit der Position, die ich für "Vollgas" halte heizt sie dann auch, aber sehr gemächlich. Nach einer halben Sunde konnte ich immer noch bequem die Hand in den Herd halten. Das Backen selbst hat dann auch fast eineinhalb Stunden gedauert, normal sind 45 Minuten. Ich glaube, dem Teig wurde einfach langweilig und so ist er freiwillig zum Brot geworden. Dafür konnte sich das Ergebnis sehen und schmecken lassen, das Brot war prima und hat auch meinen Mitbewohnern geschmeckt. Und ich hab jetzt ab und zu ne Alternative zum aufgeblasenen ultraleichtbrot aus dem Supermarkt. Das Projekt, an dem ich hier beteiligt bin, ist eine Zusammenarbeit der beiden großen Universitäten Amsterdams, der UvA (Universiteit van Amsterdam) und der VU (Vrije Universiteit). Erstere ist mein Hauptarbeitsplatz und mein Brötchengeber, an der zweiten arbeiten die Laborleute, die meine Daten liefern. Momentan stehe ich selbst im Labor, weil ich diesen Vorgang, der meine Daten erzeugt, nachvollziehen möchte. Und so spielt meine nette Kollegin Ning aus China, die normalerweise die Experimente macht, Lehrerin. Sie zeigt mir geduldig alle Schritte und ich kann die entsprechende Experimente einmal selbst durchführen. Nebenbei beantwortet sie geduldig Fragen, die nur jemand ohne Laborerfahrung stellen kann. Für den Außenstehenden sieht der Labortag etwa so aus: Wir mischen pro Arbeitsschritt zwei unglaublich kleine Mengen von irgend etwas ineinander, packen die Mischung dann in ein Gerät und warten eine halbe Stunde. Danach mischen wir das gemischte Etwas mit etwas Anderem, und packen das Ergebnis in das nächste Gerät. Und warten wieder eine halbe Stunde. Und so weiter. Am Ende wird etwas gemessen, und danach habe ich genau die Daten, die ich haben wollte. Es sei denn, etwas ist schiefgelaufen. Natürlich weiß ich mittlerweile, was wann womit und warum gemischt wird, und was dabei schieflaufen kann. Bei mir hat bislang alles geklappt, erfreulicherweise. Schade eigentlich, dass die Laboreinführung bald vorbei ist. Ich kehre dann zurück an meinen Schreibtisch und warte wieder auf Daten. Ein typischer Wochenendabendweggehplan von unserer WG sieht so aus: Wir beginnen im 'Maloe Melo', versuchen dann eine neue Rockkneipe, danach eine Studentendisco um am Ende im 'Bamboo' der Samba-Liveband zuzuhören (und um Brasilianierrinnen zuzusehen). Sehr schöner Plan! Die Abbildung des Plans auf die Realität ist nicht ganz perfekt. Freitagabend. Wir wollen halb 10 starten. Es sind italienische halb 10, heißt, wir sitzen um 10 auf den Fahrrädern. Eine halbe Stunde Fahrradfahrt bis zur Innenstadt, fast ohne Verfahren. Das 'Maloe Melo' ist leer, wir sind zu früh. Spontan überlegen wir uns, andere Kneipen auszuprobieren. Andere Kneipe Nr. eins ist langweilig und teuer. Andere Kneipe zwei voll mit Touristen. Also schauen wir mal aus Spaß bei der Disco vorbei. Die Party hat noch nicht angefangen. Also zurück zum Maloe Melo. Da ist es nun voller und wir bleiben eine Weile bis halb 12. Danach gehts zum Rockpub, der dummerweise auch um diese Uhrzeit noch erschreckend leer wirkt. Ich frage den Türsteher, wie voll es ist. Er sagt mir, dass es leer ist und man sieht, dass er darüber sichtlich frustriert ist. Wir fahren also weiter. Jede Fahrt von A nach B dauert dabei etwa 10 Minuten, pro Abend geht so bestimmt eine Stunde rum. oder wie Fabiano es formuliert hat: Wir verschwenden zu viel Zeit mit dem An- und Abschließen unserer Fahrräder. Nächste Spontankneipe, Bier, was zu Futtern. Schick, hier kommen wie wieder mal hin. Wenn wir uns erinnern, welche es war. Es ist halb 1, wir könnten mal spontan zum 'Bamboo' fahren und schauen, ob da schon was ist. Laut ist es schon mal, und wir sehen viele Leute, sieht also gut aus. Die Leute sperren grad den Weg vor dem Brasilianerpub ab. Geschlossene Veranstaltung heute. Und wir sind nicht eingeladen. Auf zurück zur Disco. Wir sehen viele Leute am Eingang und wir gehen rein. Die Disco selbst ist fast leer. Die ganzen Leute gehörten zu einer privaten Party im anderen Raum der Disco. Und wir sind wieder nicht eingeladen. Der DJ unten spielt moderne Eurodancemucke und Popmusik. Einige wenige Studenten zappeln dazu, ich bete heimlich, dass der DJ samt CD-Koffer im Boden versinkt und ein Metal-DJ vom Himmel fällt. Was nicht passiert. Wir bleiben trotzdem. Später füllt es sich und die Musik wird besser. Der Chaosabend wird insgesamt als erfolgreich eingestuft und wir erreichen unser Heim so etwa um 4 Uhr morgens. Morgen planen wir noch besser! Amsterdam ist eine Stadt der Touristen. Und weil viele Touristen jeden Abend abgefüllt werden wollen, folglich auch eine Stadt der Kneipen. Typische Touristenbars zu finden ist nicht schwer, sie sind grell, laut, auffällig und voll. Und teuer. Die höhere Kunst ist es, Kneipen zu finden, die versteckt sind, Geheimtipps gewissermaßen (≠ Geheimtipps im Reiseführer) und von außen absichtlich schlicht gehalten. Wir (das sind meine Mitbewohner Fabiano und Rafaelo, und ich) kennen mittlerweile einige schmucke Beispiele dieser Art Kneipe, die von Touristen weitestgehend übersehen werden. Gefunden haben wir sie durch chaotisches Umherfahren per Fahrrad in der Innenstadt, im Internet oder dank Arbeitskollegen. Es gibt dabei nicht das 'typisch holländische Lokal', jede Bar folgt ihrem eigenen Stil. Das 'Maloe Melo' beispielsweise. Wir haben es entdeckt, weil daneben eine Metalkneipe ist, die wir besuchen wollten. Und die haben wir im Internet gefunden. Das 'Maloe Melo' ist eine schicke 60er-Jahre Rock Kneipe, mit den Wänden voller Musikplakate, Flipperautomat, original nach 60er aussehendem Wirt und Musik von einer der tausend hinter der Bar aufgereihten Kassetten. Und lecker Bier für einen untouristisch fairen Preis. Im Raum hinten gibts live-Musik und im 50er Look gekleidete Besucher. Wir kehren hier oft ein, falls unser Abend mal wieder völlig ungeplant verläuft (dazu mehr in Teil 2). Die Metalkneipe selbst trägt den Namen 'Korsakov' und bietet auf 2 Floors gepflegten Rock. Am ersten Abend war dieser nicht so unser Fall, aber wir gehen da sicher wieder hin. Generell füllen sich Kneipen wie diese erst nach 23:00 richtig, vorher braucht man da nicht aufzuschlagen. Ein andere Gelegenheit zum Rockmusik hören ist 'the cave', sehr schmal, lang, dunkel und auch mit Liveband. Gehört haben wir dort zufällig eine ukraninische Band, die ziemlich fetten Rock fabriziert hat und Musiker aus Brasilien, die im wesendlichen auf ihre Instrumente eingedroschen haben, ohne dass für mich ein Takt, eine Melodie oder Gesang erkennbar gewesen wäre. Aber auch 'the cave' steht auf unserer Wiederkommen - Liste. Das 'Bamboo' dürfte den meisten Touristen ebenfalls unbekannt sein, es sei denn, sie kommen, so wie mein Mitbewohner Rafaelo, aus Brasilien. Er hat die Bar im Internet ausfindig gemacht. Sie ist klein, laut (brasilianische Sambamusik) und voller tanzender Brasilianer(innen). Prima Livemusik haben wir auch dort erlebt. Ich kann zwar nicht Samba tanzen (leider) aber wenigstens war ich nicht allein mit diesem Problem. Rafaelo kann tanzen und wir hatten genug zu gucken, hat also allen Spaß gemacht. Zuletzt sei das 'Bloc' erwähnt, ein total unauffälliges, winziges Cafe in einem amsterdamtypisch schmalen Haus. Es ist auf drei Etagen verteilt, die durch eine sehr enge Rolltreppe verbunden sind und von denen jede in der Breite genau einen Tisch fasst. Eigentlich sehr schlicht gehalten, hatt das Cafe doch irgendwas anziehendes, und sei es auch nur lecker heiße Schokolade. So hat jedes Lokal hier seinen ganz eigenen Charme, und unsere Suche hat erst angefangen. Wir haben noch viel Zeit zum suchen... Ich habe ja schon geschrieben, dass es in Amsterdam nur so vor Fiets (Fahrrädern) wimmelt. Heute beschreibe ich, was sich hier so alles als Fahrrad bezeichnen darf. Nämlich so ziemlich jeder fahrradähnliche Gegenstand mit zwei Rädern, auf dem man 50m fahren kann, ohne dass er in alle Einzelteile zerfällt. Generell ist das typische Hollandrad hier am häufigsten anzutreffen, mit einem schwarzen Rahmen, hoch geschwungenem Lenker und großen Rädern. Viele Fahrräder sind aber phenomenal verrostet, dem Draußenstehen im Regen sei Dank. Und alle besitzen mindestens eine der im folgenen beschriebenen Eigenschaften:
Und mein hallenser Fahrrad? Fällt natürlich auf hier. Es ist ein Mountainbike und nicht schwarz. Es fährt, ohne zu quietschen. Es hat eine intakte Schaltung. Und funktionierende(!) Hand(!)Bremsen. Und ordentliches Licht. Und seit Amsterdam zwei große, schwere Schlösser. Sonst wär es wohl nicht mehr mein Rad. Achja die Auflösung des Wörterrätsels:
Als ich die ersten Male Leute niederländisch reden gehört habe, klang es für mich immer wie englisch, aber mit völlig neuen Wörtern. Ich habe überhaupt nichts verstanden. Und das ist noch immer so. Zum Glück ist das beim Lesen anders. Viele Worte im Niederländischen sind denen im Deutschen ähnlich. Andere lassen sich auf skurrile Weise herleiten, weil sie die Sachverhalte quasi umschreiben. Und man kommt oft auf die Bedeutung, wenn man die Worte leise vor sich herspricht. Roken (=Rauchen) wirkt natürlich nicht sehr versklavend. Aber es macht abhängig. Steht hier als Warnung auf Tabakwaren. Für alle Hobbyniederländer ein kleines Wörterquiz:
Ich sitze auf Arbeit mit anderen Doktoranten in einem schicken Büro in einem ganz neu eröffneten Forschungsgebäude auf einem ganz neu eröffneten Forschungsgelände. Das Büro ist kein Raum im eigentlichen Sinne, sondern genau genommen Teil eines sehr langen Ganges, der durch große Regale (die aber nicht bis zur Decke reichen) in Bereiche aufgeteilt ist. In den Berechen sitzen die Leute. Ich zum Beispiel. Zum eigentlichen Gang ist das Ganze nur abgetrennt durch dünne, zur Seite hin verschiebbare Plexiglaspanele, man kann die Büros auch nicht komplett abschließen. Sehen tut man seine Nachbarn trotzdem nicht, hört sie aber, spätestens, wenn nebenan wer telefoniert. Irgendwie ist es (fast), als würde man im Treppenhas sitzen. Eigentlich eine interessante Idee, vielleicht kommunikationsfördernd, oder so. Ich muss mich da erst dran gewöhnen. Das Gebäude hat noch eine andere Neuentwicklung: Es nirgendwo einen Lichtschalter. Die Räume erkennen selbstständig, ob gerade jemand da ist und schalten von automatisch das Licht ein. Zusätzlich wird, je nach Sonnenlicht draußen, die Innenbeleuchtung so reguliert, dass es in den Räumen immer gleich hell ist. Klingt gut, nicht? Funktioniert dummerweise nicht so richtig. Je nach Wolke, die sich gerade draußen zwischen dem Lichtsensor auf dem Dach und der Sonne befindet, ändert sich im Gehäude die Helligkeit. Und Wolken haben bekanntermaßen die Angewohnheit, zu wandern. Also ändert sich drin andauernd die Helligkeit der Lampen ein wenig, und zwar überall. Mein Büro hat keine Sichtverbindung zur Sonne. Und dennoch ändert sich einfach mal so die Helligkeit im Raum, wenn es draußen wieder etwas dunkler geworden ist. Vor über 100 Jahren (und schätzungsweise eine Sekunde nach der Glühbirne) wurde der Lichtschalter erfunden. Ich will diese altertümlichen Dinger wieder haben. Die Uni hier hat an den Türen keine normalen Schlösser, sondern man kommt überall mit einer speziellen Chipkarte rein, die auch gleich der Uni-Ausweis ist. Die ersten Tage musste ich morgens bei den Uni-Sicherheitsleuten (auch so etwas, was es in Halle überhaupt nicht gab) vorbei und mir eine Gästekarte abholen. Jetzt habe ich meinen permanenten Mitarbeiterpass. Inklusive praktischer Aufrollschnur zum an den Klamotten festmachen. Ich bin ein Medewerker. In Amsterdam regnet es oft. SEHR OFT. An 234 Regentagen im Jahr (gegenüber 131 Nichtregentagen) fallen 779.5 mm (= L pro Quadratmeter) Wasser herunter. Eine große Regentonne voll Wasser für jeden Meter Fußweg. 1.7 mal so viel wie in Halle. Und besonders gern morgens zwischen 7 und 9, sowie zum Feierabend. Ich frage mich, wie Amsterdam zur Fahrradweltstadt werden konnte, ich wurde bisher zwei mal gründlich geduscht auf dem Weg zur Uni. Trotz Regenjacke. Willkommen bei: bescheuerte Ideen für Fortgeschrittene. Ich finde, mit der Regionalbahn nachts von nahe Halle nach Amsterdam fahren gehört in diese Kategorie. Inklusive Fahrrad. Und ca 30Kg Gepäck, verteilt auf 2 Rucksäcke (einer vorn, einer hinten) und Fahrradtaschen. Dafür ist die Idee billiger als Nachtzug oder InterCity. Und man muss das Rad nicht vorher umständlich anmelden und Platzkarten reservieren. (Außerdem äääh .. habe ich zu spät angefangen, mich um die ganze Fahrt zu kümmern, grins...) Die Reise klappt gut. Ich muss viel umsteigen, hab dafür aber immer genug / zu viel Zeit. Im Zickzack geht es Richtung Westen. Irgendwann nachts kommt das nervige 3-Stunden-Loch, also die Zeit zu der nix mehr fährt, je nach bahn zwischen 0 und 4. Ich habe die Route so gelegt, dass ich die Zeit in Münster totschlagen muss, anstatt auf einem Niemalslandbahnhof zu warten. Trotzdem ist hier (war ja zu erwarten um 2 Uhr morgens) die Hose tot. Vereinzelt Reisende auf den Bahnsteigen, die auch die Wartezeit unterschätzt haben und nun imaginären Wüstenrollern hinterherschauen. Unten in den Tunneln sitzt ein Arbeiter auf einer selbstfahrenden Reinigungsmaschine, heizt mit dem Ding durch die Flure und hat sichtlich Spaß daran. Und ich? Ich sitze gerade in einem Cafe/Dönermann der noch aufhat, lese Zeitung und schreibe das hier. Der Kaffe ist brauchbar und hält mich wach. 4:10 gehts weiter. Die Niederlande sind flach. Ich meine: so richtig flach! Das Land wirkt vom Zugfenster aus wie eine Modelleisenbahnplatte. Aber schick und weiträumig ist es. Ich fahre gerade nach Amsterdam, wurde eingeladen zu einem Jobgespräch. Das ist aber erst morgen. Gleich hinter der (virtuellen) Grenze lauern die ersten Klischees auf mich, Wohnwagen und Fahrräder. Erstere gibt es häufiger als bei uns, zweitere viel häufiger. Und es sind alles Hollandräder, mit dem Mountainbike würde man hier sofort auffallen. Klar, in einem Land ohne Mountains. Amsterdam ist laut, voll, bunt und echt schön, mit den berühmten Grachten, einem sternförmigen Wasserstraßensystem mitten in der Stadt. Und ja, an jeder vierten Ecke ist ein coffee-shop mit esoterischem Namen und Leuten davor, die Cannabisrauch in die Luft blasen. Allerdings umgibt den Bahnhof scheinbar auch das Rotlichtviertel, was man als Gast erstmal unfreiwillig streift. Ich bin kaum 10 Minuten gelaufen, da spricht mich jemand an, mit qualmendem Joint in der Hand, möchte wissen, woher ich komme (und ich hatte mich extra nicht wie ein Tourist gekleidet) und erzählt mir, dass er Dänen hasst. Ich frage ihn wieso, aber er ist zu bekifft, um mir das zu erklären. Er verzieht sich bald, samt Rauchwolke. Etwas später erfahre ich, dass gleich FussballWM Dänemark gegen die Niederlande ist, manchmal sind Gründe so naheliegend. War ja klar, ausgerechnet wenn ich in Amsterdam bin spielen die Niederländer. Jetzt fällt mir auch wieder ein, dass die Fanfarbe hier Orange ist .. in Form von T-shirts, Schmuck, Hüten, Bändern, Schals, Haaren .. halb Amsterdam läuft gerade in Orange rum. In meinen schwarzen Klamotten muss ich einfach auffallen. Jemand posaunt mir mit einer orangen Vuvuzelka hinterher. Ich durchquere die Innenstadt Richtung Hotel. Vorbei an Menschenmassen (in Orange, natürlich), über kleine und große Brücken, durch eine Blokker-Filiale (sie haben hier genau den selben Nippes wie in Deutschland) und inmitten von unglaublich vielen Fahrrädern. Sie fahren an mir vorbei, überall, pausenlos, rasant, jede Straße hat hier einen Radweg. Skurrilerweise fahren auf denen auch lauter Motorroller, schlängeln sich zwischen den Fahrrädern hindurch. Helmpflicht für die Dinger scheint es übrigens auch keine zu geben. Check-In im Hotel. Ich freue mich über meinen eben flüssig aufgesagten englischen CheckIn-Text, als der Mitarbeiter nebenan mich übernimmt - er spricht deutsch. Eigentlich fast schade. Das Hotel ist einfach und schick, mein Zimmer ist im 10. Stock mit Ausblick über die Stadt. Nur Wlan für 10 Euro pro Stunde finde ich unverschämt. Morgen hoffe ich irgendwo auf Gratis-Wlan in der Stadt. Auf der Suche nach Abendbrot finde ich in Hotelnähe internationale Küche, also McDonalds. Das Stadtgebiet hier ist so eine Art Schmelztiegel der Kulturen, in der Filiale sind Afrikaner, Asiaten, Türken, Araber. Und ein Deutscher. (Verdammt, ich falle schon wieder auf.) McDonalds ist unter anderem deswegen in der Welt beliebt, weil sie in einigen armen Gegenden armer Länder das einzige einigermaßen keimfreie Essen anbieten, wegen der internation Standards, die der Konzern vorschreibt. Dies sind NICHT die deutschen Standards, musste ich lernen - wir können uns über die Sauberkeit und das Essen in den deutschen Filialen sehr glücklich schätzen! Ich bestelle und nehme das Essen mit. Noch bevor ich die Tüte einpacke, wird sie außen dort transparent wo innen die Pommes liegen. Der Burger zerfällt beim Transport in all seine Einzelteile und weicht seinen Pappkarton durch. Das Essen ist gerade so genießbar. Die Niederlande gewinnen gegen Dänemark 2:0 und eines der Tore ist von den Dänen hausgemacht. Der Schmelztiegel ist laut, aber wenigstens friedlich. Nächster Tag. Man nehme: eine große Flasche billiges Mineralwasser mit Apfelgeschmack und dampfe den Inhalt auf Hotelshampooflaschengröße ein. So in etwa ist mein Duschbad im Hotelzimmer entstanden, anders ist der penetrante künstliche Geruch nicht zu erklären. Dampft man das Ganze weiter ein bis die Masse fest wird, so erhält man meine Seife. Sie stinkt selbst durch die Folie extrem nach Aromastoff und ich werde sie definitiv nicht auspacken. Mein Frühstück ist nicht im Hotelpreis inbegriffen, den die Uni hier bezahlt. Anstatt 18 Euro für das Buffet zu berappen mache ich einen Morgenspaziergang. Ich finde ein kleines Cafe, darin belegte Baguettes und Espresso und freundliche Bedienung. Für ein Viertel des Preises. Die meisten Leute hier sprechen englisch, die Kellner in den Restaurants, die Frau an der Kasse im Supermarkt. Das macht Einkaufen und Bestellen einfach, obwohl Speisekarten mir Rätsel aufgeben und ich aus manchen Läden wirklich nicht schlau werde, was sie anbieten. Es ist eigenartig, den ganzen Tag englisch zu reden, aber man gewöhnt sich erstaunlich schnell daran. Meine Gespräche mit der Uni verlaufen prima, ein Ergebnis gibt es aber noch nicht. Jetzt ist es Abend, ich wandere touristentypisch durch die Stadt. Irgendwann sagt mir mein Magen, dass das Cafe, an dem ich gerade vorbeilaufe, gemütlich ist und ich gehe rein. Er hat recht. Der Kaffee schmeckt, ich futtere Kürbissuppe und finde sogar ein offenes Wlan von einem der Häuser nebenan. Wie gut, dass ich die ganze Zeit mein Notebook rumgetragen habe. Und spät Abends? Fußball-WM. Nordkorea gegen Brasilien 1:2, was in Nordkorea bestimmt zur nationalen Heldentat hochstilisiert wird. |
Dezember 12. | September 10. | Mai 10. | Januar 09. | Oktober 11. | September 10. | August 17. | Juli 27. | Juni 17. | Mai 25. | 16. | 1. | März 29. | 19. | 9. | Februar 19. | 10. | 07. | Januar 22. | 10. | 02. | Dezember 22. | 13. | November 29. | 18. | Oktober 29. | 25. | 19. | 13. | September 30. | 23. | 21. | 17. | 15. | 10. | Juni 14. |        |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||